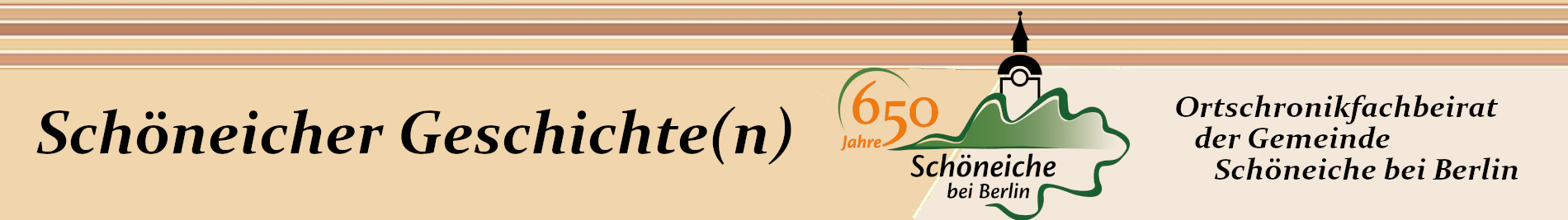Zur Geschichte von Grätzwalde und Hohenberge
Grätzwalde und Hohenberge sind die jüngsten Kolonien von Kleinschönebeck, dennoch haben einige Straßen bereits die Namen gewechselt, manche sogar zweimal. Zum ersten Mal nach der Zusammenlegung der Dörfer Schöneiche und Kleinschönebeck zur Gemeinde Schöneiche bei Berlin, um Namensdopplungen zu vermeiden und zum zweiten Mal in den in den 1950-er Jahren.
So wurde z.B. aus der Grätzwalder Akazienstraße erst die Erich-Timm-Straße und danach die Watenstädter Straße.
Grätzwalde
Grätzwalde wurde 1903 gegründet und auf ehemaligem Ackerland der Brüder Karl und Ernst Grätz gebaut. Festgelegt wurde, dass jedes Haus einen Garten mit festgelegter Anzahl von Obstbäumen und Obststräuchern haben musste. Wie in Fichtenau gab es eine Pflasterkasse für den Straßenausbau.
An der heutigen Stockholmer Straße stand ein Holzhaus – Immobilienbüro mit Ausschank und Anlaufpunkt für Grundstücks-Interessenten, betrieben von Herrn Holzbrecher. Dieser Ort wurde zur Keimzelle der Kolonie und aus dem Ausschank wurde später die Gaststätte Heidehof – vielbesucht bis zum Ende der 70-er Jahre. Danach verfiel das Gebäude, bis es 1982 von der Malerin Ulla Walter erworben und der besser erhaltene Saal als Wohnhaus und Atelier umgebaut wurde.
Am nördlichen Ende von Grätzwalde, an der Woltersdorfer Straße, hat Ernst Grätz 1908 die Gaststätte Zum Wilden Mann gebaut, bald ergänzt durch ein Kolonialwarengeschäft. Sein Sohn Reinhold führte die Wirtschaft und Sohn Kurt das Geschäft. Zum Gasthaus Grätz gehörten ein großer Garten mit Obstbäumen und später noch ein kleiner Tierpark. Den hatte Reinhold Grätz zusammen mit dem ehemaligen Zoo-Tierwärter Petrus Olesen eingerichtet. Die Tiere stammten aus dem Berliner Zoo, im Tausch gegen Futter, und waren besonders bei den Kindern beliebt.
Heute steht das Gemeindehaus Helga Hahnemann an der Stelle der alten Gaststätte.
In der Wittstockstraße 11 und 6-8 befanden sich Wohnhaus und Kinder-Erholungsheim von Prof. Franz Schönenberger, Leiter der Anstalt für Hydrotherapie in Berlin und erster Universitätslehrer für Naturheilkunde in Deutschland. Das Haus Nr. 6-8 wurde nach 1952 zunächst Altenheim und dann Blindenheim.
Das Gelände in der Prager Straße / Ecke Watenstädter Straße war bis zum Bau der Schule in den frühen 1970-er Jahren ein kleiner Park mit einem Kriegerdenkmal für die Kleinschönebecker, die im I. WK gefallen waren. Er hieß zuerst Tannenberg-Park, dann Adolf-Hitler-Park und Ernst-Thälmann-Park.
Hohenberge (Fichtenauer Höh‘)
1905 wurde ein Plan zur Anlage einer neuen Kolonie für das Gelände südöstlich von Grätzwalde bis nach Woltersdorf erstellt. Der Bauunternehmer Otto Schramm erwarb große Flächen, ließ sie parzellieren und vermarktete sie in den darauffolgenden Jahren. Sein Partner, der Architekt Emil Stamm entwarf verschiedene Haustypen für die Grundstückskäufer.
Das große Gelände an den Fuchsbergen stellte Otto Schramm 1931 dem Berliner Flugsportverein Adler, gegründet von arbeitslosen Jugendlichen, als Übungsgelände zur Verfügung. In seiner Scheune standen die Segelflugzeuge.
1927 gründete sich ein Siedlerverein im Verbund mit Invalidendank, dem Verein zur Förderung der Erwerbsfähigkeit deutscher Invaliden (gegr. 1872), um auf dem Gelände einer ehemaligen Spargelplantage Häuser zu bauen. Die Invalidendank-Siedlung entstand zwischen den heutigen Straßen Falkenhorst, Stargasse und Adlerstraße und wurde bereits 1929 bezogen, obwohl es noch keine befestigten Straßen gab. Die Grundstücke sind so dimensioniert, dass Vieh gehalten und Eigenbedarfs-Anbau betrieben werden konnte.
Bis in die 1990-Jahre war das Gelände am Rosengarten unbebaut. Der Sage nach sollte es dort nicht geheuer zugehen. Bei Ausgrabungen zu Beginn des 20. Jh. durch den Amateur-Archäologen Hermann Busse wurde dort ein bronzezeitliches Urnengräberfeld gefunden.
Der Jägerpark zwischen Kieferndamm und Jägerstraße wurde 2004 als jüngster Park von Schöneiche angelegt.